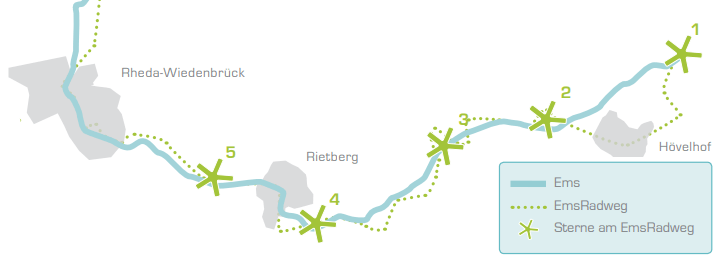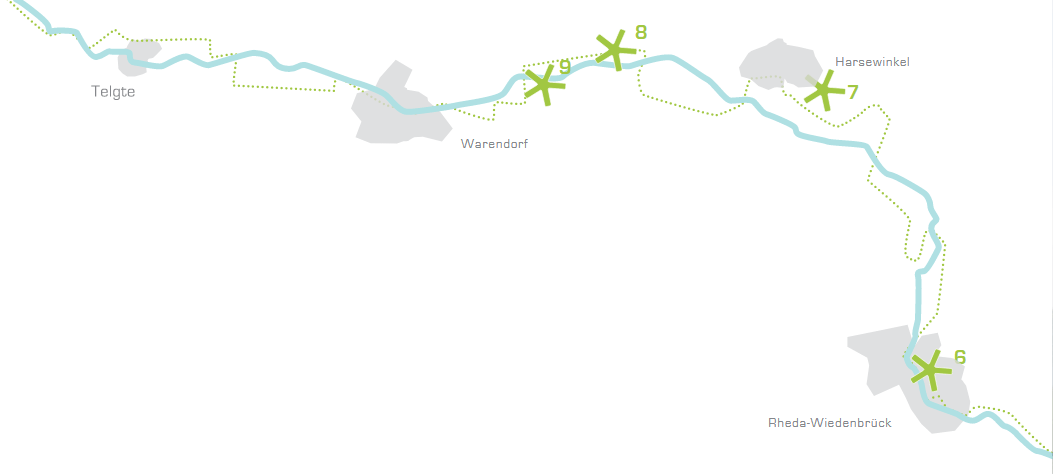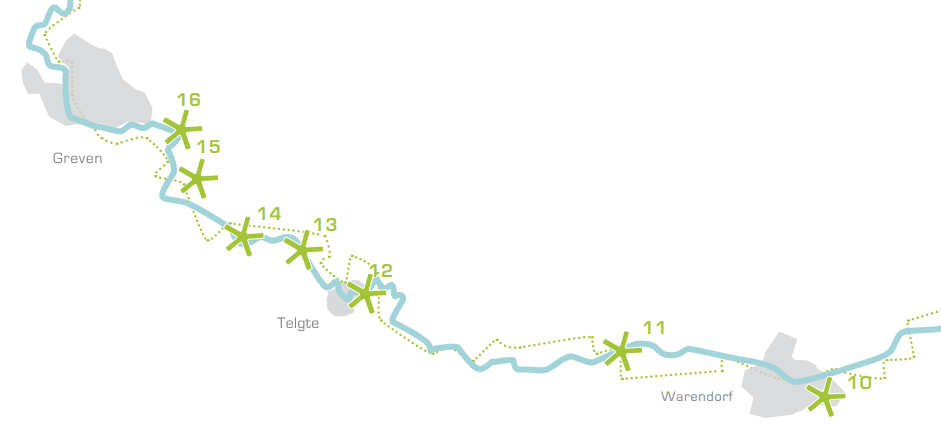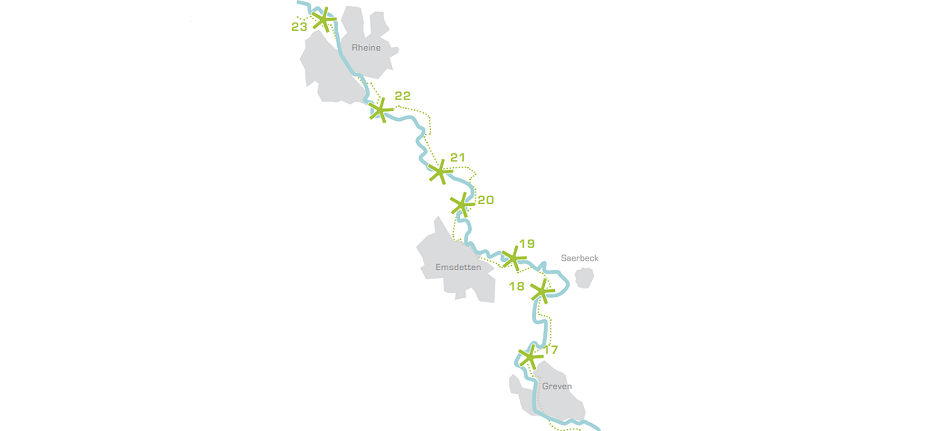Sterne am Emsradweg
Emsquelle
Der Fluss nimmt seinen Lauf
Der Anfang ist bedächtig. Das Quellwasser der Ems macht sich nicht überschäumend sprudelnd auf den 371 Kilometer langen Weg zur Nordsee, sondern sickert eher gemächlich aus dem sandigen Boden. Rund 35 kleine Quell-Rinnsale sind nötig, um einen gut erkennbaren Bachlauf mit seinen typischen „Rippeln“ im hellen Sandboden zu bilden. Diese für die meisten Sennebäche typische Quellsituation ist von einem Holzsteg und einer neuen, barrierefreien Aussichtsplattform aus gut erlebbar.
Das Quellwasser der Ems ist kalkreich, weil der Regen sich zuvor den Weg durch das klüftige Kalkgestein des Teutoburger Waldes gebahnt hat. Die Ems ist einer von rund 30 Bächen und Flüssen, die in der Senne entlang eines Quellhorizontes entspringen. Eine anfängliche Begleiterin der Ems ist die Brunnenkresse, die kühles und klares Wasser mag. Eher versteckt leben viele andere Quellbewohner wie die Köcherfliegenlarven, die sich in einem selbst gebauten Köcher aus Sandkörnern oder Blattresten entwickeln.
Die Emsquellen sind eingebettet in das Naturschutzgebiet Moosheide. Es bietet mit Mooren, Heideflächen und Bachtälern bis hin zu Sandäckern die ganze Vielfalt des einmaligen Lebensraums Senne.


Steinhorster Becken
Geplante Natur
Als Naturparadies war das Steinhorster Becken ursprünglich nicht gedacht. Es sollte bei starken Niederschlägen die Wassermassen der Ems zurückhalten, die bis dahin ungebremst durch Rietberg und Rheda-Wiedenbrück flossen und oft für Überschwemmungen sorgten. Doch bei einem Probeanstau fanden Wasser- und Watvögel Gefallen an dem künstlichen Gewässer. Naturschützer entwickelten die Idee, die Ems anzustauen und das Becken so dauerhaft mit Wasser zu füllen.
Innerhalb von vier Jahren entstand bis zum Jahr 1990 auf 82 Hektar ein vielfältiges Mosaik an Lebensräumen. Unterschiedlich tiefe Gewässer locken Rastvögel an und sind ideal für Amphibien und Libellen.
In den Röhrichtzonen brüten Rohrammer und Zwergtaucher, und die Feuchtwiesen bieten Kiebitzen und Uferschnepfen ein reiches Angebot an Nahrung. Im Winter beherrschen Gänse die Szenerie, die auf den Teichen sichere Schlafplätze finden.
Ein bis zu 20 Meter breiter äußerer Ringgraben sorgt für Ruhe im Gebiet, das unter Naturschutz steht. Auf spannende Naturbeobachtungen müssen die Besucher dennoch nicht verzichten. Der begehbare Damm, der das Becken umschließt, und zwei Aussichtstürme bieten hervorragende Möglichkeiten, die „Natur aus zweiter Hand“ zu erleben.


Rietberger Emsniederung
Vertrag mit dem Brachvogel
Altwässer, Niedermoore und feuchte Wälder prägten ursprünglich den Oberlauf der Ems. Der Mensch verwandelte die Aue in eine feuchte Wiesen- und Weidelandschaft. Wiesenvögel wie der Große Brachvogel und die Uferschnepfe ziehen hier im Frühjahr ihre Jungen auf. Ihr Schutz steht im EU- Vogelschutzgebiet „Rietberger Emsniederung mit Steinhorster Becken“ im Vordergrund.
Weil die eingedeichte Ems auf Höhe der Rietberger Fischteiche angestaut ist, liegt ihr Wasserspiegel über dem Niveau der feuchten Wiesen. In ihnen kommen das seltene Sumpfblutauge und die Sumpf-Dotterblume ebenso vor wie die gefährdete Sumpfschrecke und der Sumpf-Grashüpfer.
Voraussetzung ist eine extensive Bewirtschaftung, die vertraglich geregelt und mit der Biologischen Station Gütersloh/Bielefeld abgestimmt ist, die das Gebiet betreut.
Hecken und höhlenreiche Kopfweiden gliedern die Emsniederung und sind zugleich Brutplätze für Steinkauz, Star und Feldsperling. Von zeitweilig austrocknenden Gewässern, den „Blänken“, profitieren konkurrenzschwache Pflanzen wie die Salzbunge sowie Libellen, darunter die Südliche Binsenjungfer und die Schwarze Heidelibelle.


Rietberger Fischteiche
Grafen, Karpfen und Vögel
Gräfliche Residenz, Fischteiche, Vogelparadies – das Gebiet der Rietberger Fischteiche hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich.
Ein Gutshaus ersetzte im 19. Jahrhundert das abgerissene Schloss der Grafen von Rietberg. In der ehemaligen Schlossgräfte legten die Gutsbesitzer Anfang des 20. Jahrhundert eine rund 50 Hektar große Fischzuchtanlage mit 25 Teichen an, in denen sich Karpfen und Schleien tummelten. Gespeist wurden die Teiche mit dem Wasser der Ems.
Nach Aufgabe der Fischzucht entwickelten sich wertvolle Biotope, die vor allem für Vögel von großer Bedeutung sind. Teichrohrsänger, Rohrammer und Wasserralle nutzen das Schilfröhricht zur Brut, während Uferschnepfen und Brachvögel aus den benachbarten Emswiesen einfliegen und im Schlamm nach Nahrung stochern.
In den Sommermonaten verwandeln Seerosen die Teiche in ein Blütenmeer. Unscheinbare Raritäten sind dagegen Schlammling und Tännel, die im Spätsommer den trocken gefallenen Teichboden überziehen. Zu den Zugzeiten hält der Fischadler nach Beute Ausschau, während im Winter die Rohrdommel im Schilf ein heimliches Dasein führt.


Emssee
Reiche Fischzüge
Bei fast allen größeren Seen entlang des EmsRadwegs hat der Mensch seine Hand im Spiel gehabt. Die meisten sind entstanden, weil der Sand, mit dem die Ems nach der Eiszeit ihre Aue auskleidete, ein begehrter Baustoff ist. Auch der 12 Hektar große Emssee ist eine ehemalige Sandgrube. Was ihn von vielen „Baggerseen“ entlang der Ems unterscheidet, ist die Ungestörtheit. Wer angeln, jagen oder sich Badefreuden hingeben will, ist hier fehl am Platze.
Dies kommt vor allem ruhebedürftigen Vogelarten zugute. Haubentaucher, Reiherenten und Graugänse brüten am Emssee, Krick- und Tafelenten und sogar der Fischadler geben sich hier alljährlich zu den Zugzeiten im Frühjahr und Spätsommer ein Stelldichein.
Das klare Wasser lockt den Eisvogel an, der Kleinfische aus dem Wasser holt. Etwas „dickere Brocken“ schnappt sich der Kormoran. Durchzügler wie Kiebitz, Wald- und Bruchwasserläufer bevorzugen die flachen Ufer im Norden des Sees für die Nahrungssuche.
Unterwasserpflanzen und eine Schwimmblattvegetation fehlen dem Emssee weitgehend. Wo der Seeboden im Sommer trocken fällt, sind Pionierpflanzen wie Zwergbinsen rasch zur Stelle. Alte, höhlenreiche Kopfweiden an einigen Uferabschnitten markieren den Übergang zum angrenzenden Grünland. Einen schönen Überblick über den See bietet die direkt am EmsRadweg gelegene Aussichtsplattform.


Schlosswiesen Rheda
Natur trifft Park
In Rheda-Wiedenbrück verläuft der EmsRadweg mitten durch den Flora Westfalica-Park, einem ehemaligen Landesgartenschaugelände. Als fast drei Kilometer langes grünes Band entlang der renaturierten Ems verbindet er die beiden Stadtteile Rheda und Wiedenbrück. Herzstück des Parks ist das erstmals im Jahr 1170 erwähnte Wasserschloss Rheda.
Es liegt inmitten eines Naturschutzgebietes mit Feuchtwiesen und einem Erlenbruchwald. Der hohe Grundwasserstand beruht auf einem künstlichen Anstau der Ems und ist erforderlich für den Erhalt der Eichenpfähle, auf denen das Schloss erbaut ist.
Vor dem Schloss wuschen die Frauen früher mit Wäschestampfer und Waschbrett die Wäsche, um sie anschließend zum Bleichen in der Sonne auf den Wiesen auszubreiten. In den nassen Bleichwiesen, die heute landwirtschaftlich genutzt sind, wachsen Kuckucks-Lichtnelke, Wasser-Greiskraut und Teufelsabbiss, die vielerorts selten geworden sind.
Der Erlenbruchwald an der Ems ist im Winter überflutet, was außer der Schwarz-Erle keine Baumart verträgt. Im Frühjahr überziehen Sumpf-Dotterblume, Schwertlilie und Scharbockskraut den Wald mit einem gelben Blütenteppich. Mit etwas Glück kann man den Kleinspecht beobachten oder über der Ems den schillernden Eisvogel fliegen sehen.


Boomberge
Bedeutende Binnenbühnen
Die Boomberge sind mit ihren mageren Sandstandorten ein bedeutendes Binnendünengebiet im Emstal. Ausgangs der letzten Eiszeit, vor mehr als 10 000 Jahren, zogen sich die Eismassen langsam zurück. Starke Winde fegten über die blanke, vegetationsfreie Landschaft und verfrachteten die leichten Sandpartikel oft kilometerweit, um sie an anderer Stelle als Dünen abzulagern. Sie sind hier in den Boombergen besonders mächtig.
Rodung und Waldweide begünstigten seit dem Mittelalter in den Boombergen die Bildung ausgedehnter Heideflächen, in denen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts Schafe weideten. Dann wurde die Heide mit genügsamen Kiefern aufgeforstet.
Unter ihrem lichten Schirm siedelten sich Laubgehölze wie Eichen, Birken und Ebereschen an. Eine Etage tiefer wachsen gefährdete Pflanzen wie Glockenheide und Preiselbeere. An Waldrändern und auf Lichtungen brüten Baumpieper und Trauerschnäpper.
Offene und besonnte Stellen in den Boombergen sind ein Refugium für Silbergras, Bauernsenf und Frühlings-Spark. Im lockeren Sand graben Wildbienen ihre Bruthöhlen.


Talgräben Vohren
Die Ems-Eskorte
Zwischen Harsewinkel und Warendorf wird die Ems zu beiden Seiten von Talgräben begleitet. Ohne sie wäre schon vor der Flussregulierung eine intensivere landwirtschaftliche Nutzung der Aue kaum möglich gewesen. Die Ems führt eine Menge Sand mit sich, der sich am Grund und bei Überflutungen im Uferbereich ablagerte.
Dies führte im Laufe der Zeit zu einer Erhöhung des Flussbettes und zur Ausbildung so genannter Uferwälle, die das natürliche Gefälle in der Aue umkehrten. Überflutungs- und Regenwasser floss nicht ab, sondern sammelte sich am Rand der Aue vor den Terrassenkanten und sorgte dafür, dass es für eine Bewirtschaftung zu nass war.
Erst die im 19. Jahrhundert und später beim Emsausbau angelegten Talgräben schafften Abhilfe, indem sie das Wasser abführten. Heute haben sich die Talgräben mit Schwimmblattgesellschaften, Röhrichten und Hochstaudenfluren zu einem wertvollen Lebensraum entwickelt.
Die Helm-Azurjungfer, eine europaweit gefährdete Libelle, hat im nördlichen Talgraben eines ihrer wenigen Vorkommen in Nordrhein-Westfalen. Von der Neuen Mühle aus, rund 100 m südlich des EmsRadweges, kann man sie beobachten.
Das Mühlrad des denkmalgeschützten Gebäudes ist nicht mehr vorhanden. Und wäre heute wohl auch ziemlich nutzlos. Die Ems, die einst die Mühle antrieb, fließt seit der Kanalisierung vor 80 Jahren 200 Meter weiter südlich…


Dünen bei Dackmar
Das mächtigste Binnendünen-System Nordwestdeutschlands begleitet die Ems. Sowohl der Wind als auch der Mensch haben ihren Teil dazu beigetragen.
Zunächst waren es Stürme, die ausgangs der letzten Eiszeit die Dünen aufwehten. Sie bewaldeten sich später mit Eichen, Birken und Buchen. Holz, das die Menschen im Mittelalter gut gebrauchen konnten. Sie rodeten den Wald – und sorgten dafür, dass der feine Sand dem Wind erneut schutzlos ausgesetzt war. In Dackmar schafften es erst die vor 200 Jahren aufgeforsteten Kiefern, den Sandverwehrungen Einhalt zu gebieten.
Nährstoffarmer lockerer Sand, den die Sonne im Sommer ordentlich aufgeheizt und der kaum Wasser speichert – das macht Dünen zu einem Fall für Spezialisten. Offene , unbewaldete Dünen sind ein äußerst spannender Mirkokosmos. Die Sand-Segge „vernäht“ mit unterirdischen Ausläufern den Sand, der Ameisenlöwe baut Sandtrichter als tödliche Falle für Ameisen, Sandlaufkäfer jagen kleinere Insekten und die Keulenschrecke passt sich mit ihrer Färbung dem Sandboden perfekt an. Ein Schauspiel, das nur noch selten zu beobachten ist, weil offene Dünen heute selten sind. Teilweise Ersatz bieten Sandwege und sandige Böschungen.


Warendorfer Glatthaferwiesen
Blütenträume an der Ems
Die Warendorfer Emswiesen gehören zu den schönsten am EmsRadweg. Im Frühsommer recken Margeriten dicht an dicht ihre weißen Blütenköpfe zum Himmel, während Wiesenbocksbart und Wiesen-Flockenblume bunte Farbakzente setzen. Wo der Boden feuchter ist, bereichern Kuckucks-Lichtnelke und Wiesenschaumkraut das Farbenspiel. Solch eine üppige Blütenpracht erfreut nicht nur das menschliche Auge, sondern macht auch viele Insekten satt. Schmetterlinge wie der Hauhechel-Bläuling flattern von Blüte zu Blüte, und der Bunte Grashüpfer macht sich mit einem lang anhaltenden Schwirren auf Partnersuche.
Buntblumige Glatthaferwiesen gehören nicht nur zu den artenreichsten, sondern auch zu den seltenen Lebensräumen, die europaweit geschützt sind. Der Glatthafer und die anderen typischen Arten fühlen sich vor allem dann wohl, wenn die Wiesen zwei Mal gemäht und nur wenig oder gar keinen Dünger bekommen. Bei einer intensiven Nutzung verschwinden sie. Die Warendorfer Emswiesen profitieren davon, dass sie in einem Trinkwassergewinnungsgebiet liegen. Eine starke Düngung oder gar ein Herbizideinsatz kommen hier nicht in Frage.


Ems bei Einen
Ihr heutiges Gesicht verdankt die Ems dem Ausbau, der in den 1930er Jahren begann und sich bis in die 1970er Jahre hinzog. Keine 20 Jahre später gab es erste Überlegungen, die Begradigung des Flusses zumindest teilweise rückgängig zu machen. Das Ems-Auen-Schutzkonzept sieht vor, die engen Verflechtungen zwischen der Ems und ihrer Aue wiederherzustellen.
Nicht weit vom Dorf Einen laufen seit 2009 die bislang umfangreichsten Maßnahmen, um der Ems einen Teil ihrer früheren Dynamik zurückzugeben. Ein von der EU und dem Land NRW gefördertes Projekt hat zum Ziel, der Ems auf einem fast 4 Kilometer langen Abschnitt mehr Entfaltungsmöglichkeiten einzuräumen. Baggerschaufeln haben den Lauf der Ems verlängert und neue Überflutungsräume angelegt, in denen der Fluss „arbeiten“ kann. Was er sich an einer Stelle nimmt, schwemmt er woanders wieder an. Pioniere unter den Tieren und Pflanzen sind in der Lage, neue Sandbänke rasch zu besiedeln. Auch unter der Wasseroberfläche verändert sich einiges. Es bilden sich unterschiedliche Strömungsverhältnisse, von denen die Fischfauna profitiert, wie erste Untersuchungen belegen.


Emsauenpark in Telgte
Der Emsauenpark in Telgte ist ein innerstädtischer Park der etwas anderen Art. Blumenrabatten sucht der Besucher hier vergeblich. Die Planer, die Mitte der 1980er Jahre die Umgestaltung bis dahin landwirtschaftlich genutzter Flächen in Angriff nahmen, hatten anderes Sinn. Sie wollten Elemente der Auenlandschaft, die dem Emsausbau zum Opfer gefallen waren, erlebbar machen. Der EmsRadweg führt daher vorbei an artenreichen Wiesen und Gewässern, die Altarmen oder Flutmulden nachempfunden sind. Ein feuchter Auwald ist mit einem Bohlenweg erschlossen.
Für den „Grünen Stern“ ist an vielen Stellen nachgebessert worden. Entschlammte und freigeschnittene Teiche, neue Flachwasserzonen und mit artenreichem Mahdgut „beimpfte“ Wiesen sorgen für noch mehr Artenvielfalt im Park. Nutznießer ist beispielsweise der europaweit geschützte Kammmolch, der besonnte Teiche schätzt.
Die Lage am Fluss war für Telgte Segen und Fluch zugleich. Eine Emsfurt am Treffpunkt mehrerer Handelsstraßen begünstigte im Mittelalter die Entwicklung der Stadt. Zugleich richtete die Ems bei Hochwasser große Schäden an. Der Emsauenpark hat daher auch eine wichtige Funktion als natürlicher Überflutungsraum.


Weidelandschaft Pöhlen
Wenn ein Gebiet entlang des EmsRadweges einen Hauch von Wildnis vermittelt, dann ist es die Weidelandschaft „Pöhlen“. In einer alten, verlandeten Flussschlinge der Ems sind Gewässer, sumpfige Wiesen, trockene Sandkuppen und Gehölze eng miteinander verzahnt. Die Landschaft ist ständigen Veränderungen unterworfen. Dafür sind neben Hochwassern auch halbwild lebende Rinder und Pferde verantwortlich. Die vom NABU betreute Herde durchstreift das 27 Hektar große Gebiet und löst durch Tritt und Verbiss dynamische Prozesse aus. Die eindrucksvollen Tiere verhindern eine zu starke Verbuschung und schaffen mit ihren Hufen offene Bodenstellen, die seltene Wildbienen und Käfer nutzen. Im Grünland wechseln sich trockene und feuchte Bereiche auf oft engem Raum ab. Entsprechend artenreich ist die Pflanzenwelt.
In den Gewässern leben seltene Amphibien wie der Kammmolch. An warmen Maiabenden ist das Konzert der Laubfrösche weit zu hören. Nutznießer des Amphibienreichtums ist die Ringelnatter. Von Beobachtungstürmen aus kann der Besucher die Landschaft gut überblicken. Das Weidegebiet „Pöhlen“ steht in Verbindung mit dem angrenzenden Naturschutzgebiet „Haus Langen“. Hier fließt die Bever in engen Kurven der Ems zu.


Emsaue Vadrup
An kaum einem Emsabschnitt hat sich in den vergangenen Jahren soviel verändert wie nordöstlich von Telgte. Heckrinder und Koniks streifen durch die Aue und beeinflussen die Landschaft durch ihr selektives Fraßverhalten. Aber auch am Fluss selbst hat sich viel getan. Emsschleifen, die nach dem Ausbau fast 70 Jahre vom Fluss abgetrennt waren, werden heute wieder durchströmt. Ein eindrucksvolles Beispiel ist „Ringemanns Hals“. Eine Aussichtskanzel ermöglicht einen Blick über die große Emsschleife. Durch die Anbindung von drei Altarmen verlängerte sich der beim Ausbau in den 1930er Jahren stark verkürzte Lauf der Ems insgesamt um mehr als einen Kilometer.
Zugleich wurde das Steinkorsett, das die Ems in ein enges Bett zwängt, stellenweise entfernt. Von einer weiteren Aussichtsplattform wird deutlich, welche Dynamik der „entfesselte“ Fluss entfaltet. Vom Wasser unterspülte Ufer brechen ab, Sandbänke bilden sich neu. Eisvögel und Uferschwalben bauen in den frischen Steilwänden ihre Brutröhren, während der Flussregenpfeifer auf sandigen Uferbänken seine perfekt getarnten Eier legt. Jedes Hochwasser hinterlässt Spuren – und neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen.


Bockholter Berge
Die Bockholter Berge sind eine Besonderheit am EmsRadweg. Nur hier, unweit des Dörfchens Gimbte, sind die ausgangs der letzten Eiszeit aufgewehten Emsdünen mit einer Wacholderheide bedeckt. Sie zu erhalten hat schon so manchen Tropfen Schweiß gekostet. Ehrenamtliche Naturschützer reißen regelmäßig Brombeeren und andere aufkommende Gehölze aus dem sandigen Boden. Unterstützt werden sie von einer Schafherde, die einige Wochen im Jahr durch die Heide zieht und die Vegetation kurz hält. Wenn selbst das nicht mehr ausreicht, kommt schweres Gerät zum Einsatz. Alleine schaffen Besenheide, Wacholder und andere lichthungrige Pflanzen es nicht, sich der übermächtigen Konkurrenz der Bäume zu erwehren.
Die Mühe lohnt. Seltene Pflanzen und Tiere wie Bauernsenf, Silbergras, Sandlaufkäfer und Zauneidechse haben in den Bockholter Bergen ein wichtiges Refugium. Für die Besucher ist ein Spaziergang durch die Heide eine Reise in die Vergangenheit, denn noch vor 200 Jahren war die Heidelandschaft rechts und links der Ems allgegenwärtig. Die ausgewiesenen Rundwege in den Bockholter Bergen führen auch zum Gellenbach. Begleitet von Steilufern, in denen der Eisvogel brütet, fließt er durch das Naturschutzgebiet.


Altarm Hassel
Altarme sind ein typischer Bestandteil von Auenlandschaften. Flüsse, zumal, wenn sie wie die Ems nur ein geringes Gefälle haben, bilden Schleifen oder Mäander aus. Die Schleifen werden im Laufe der Zeit immer enger und meist bei einem Hochwasser durchstochen und vom Flusslauf abgetrennt. Altarme können aber auch „künstlicher Natur“ sein, wenn der Mensch Flüsse begradigt hat.
Der „Altarm an der Hassel“ südlich von Greven ist so ein „menschengemachter“ Altarm. Er wurde in den 1930er Jahren beim Ausbau der Ems vom Flusslauf „abgehängt“. Zusammen mit den angrenzenden Wiesen und Weiden, in denen es kleinere, im Frühjahr mit Wasser gefüllte Mulden gibt, ist er ein Eldorado für viele Tier- und Pflanzenarten. Schwanenblume, Langblättriger Ehrenpreis und Nickende Distel blühen hier, der Eisvogel sitzt auf überhängenden Ästen und lauert auf Beute und die Haubentaucher machen mit ihren Jungen im Rückengefieder Ausflüge.
Im Auwald westlich des Altarms wachsen als Besonderheit viele Buchen. Die Buche meidet Auwälder für gewöhnlich, weil sie nasse Füße und deshalb Überflutungen nicht mag. Da das Wasser in dem sandigen Untergrund aber rasch versickert, kann sie sich hier behaupten.


Die Wentruper Berge
Wenn ein Gebiet am EmsRadweg den Zusatz „Berge“ verdient hat, dann die Wentruper Berge. Um mehr als 20 Meter überragen einzelne Dünenkuppen die Emsaue, so hoch wie nirgends sonst am Fluss. Stürme wehten ausgangs der letzten Eiszeit den Sand zu Dünen auf, die bis in das 19. Jahrhundert hinein immer wieder auf Wanderschaft gingen. Offene Sand- und Heideflächen gaben den Wentruper Bergen damals einen anderen Charakter als heute. Erst durch Aufforstungen gelang es, die Dünen „sesshaft“ zu machen.
Heute sind die Wentruper Berge bewaldet. Besonders wertvoll sind naturnahe Wälder mit Eichen und Birken. Sie gehören zu den besonders geschützten Lebensräumen. Im Unterwuchs hat sich in den vergangenen Jahren die Brombeere breit gemacht, die von Stickstoffeinträgen aus der Luft profitiert.
Zu den Brutvögeln der Wentruper Berge gehören Spechte, Kleiber und der Sperber. Sturm „Kyrill“ hat einige Lücken in den Wald gerissen. An einer Stelle ist der Baumbewuchs entfernt und der humose Oberboden abgeschoben worden, damit Pflanzen und Tiere offener Sandböden sich ansiedeln können.


Hembergen
Hembergen liegt direkt am Fluss. Nur gut 100 Meter sind es vom Ufer der Ems bis zur Pfarrkirche, deren Ursprünge im beginnenden 13. Jahrhundert liegen. Rund acht Meter Höhenunterschied sind dabei zu überwinden – genug, um den Dorfkern vor Überschwemmungen zu schützen. Während die Ufer auf Höhe des Dorfes gut befestigt sind, hat man die Ems weiter flussaufwärts von ihrem Steinkorsett befreit. Die neu entstandenen Steilufer hat die Uferschwalbe rasch für sich entdeckt.
Für Dorfbewohner gehörte der Fluss früher zum Alltag. Er lieferte Nahrung in Form von Fischen, war Waschküche und Viehtränke und diente zum Transport von Waren. So passierten zwischen 1839 und 1842 mehr als 1000 Holzflöße über die Ems das Dorf, vor allem Eichenstämme, die bei Telgte und Warendorf eingeschlagen und zu Schiffsbauzwecken nach Leer und Papenburg geflößt wurden. Ein wichtiger Nebenerwerb war die Herstellung von flachen Weidenkörben, den Wannen. Die Wannenmacher schnitten die Ruten am Emsufer oder in den feuchten Niederungen.
Der Mensch hat die Nähe zum Fluss schon immer gesucht. Ein Beispiel ist der drei Kilometer vor Hembergen direkt am EmsRadweg gelegene Sachsenhof. Die Rekonstruktion einer Hofanlage aus dem 9. Jahrhundert zeigt anschaulich, wie unsere Vorfahren gelebt haben.


Emsaue. Hembergen/Emsdetten
Fast die gesamte Emsaue im Regierungsbezirk Münster steht unter Naturschutz. Die Grenze der Aue markiert eine markante Geländestufe, die so genannte Terrassenkante. Sie ist oft mit einem schmalen Waldstreifen aus Buchen und Eichen bewachsen.
Zwischen Hembergen und Emsdetten führt der EmsRadweg entlang der „Auenkante“. Wenn nicht gerade Hochwasser herrscht, versteckt die Ems sich in ihrem Bett. Lediglich Weidengebüsche am Ufer verraten ihren Lauf. Die Ems hat sich seit ihrer Begradigung immer tiefer in den sandigen Untergrund eingegraben. Ein Aussichtsturm ermöglicht dennoch den Blick auf den Fluss. Mit etwas Glück lässt sich in der Aue eine Rohrweihe bei der Nahrungssuche beobachten. Sie brütet in der Emsaue in Schilfbeständen, die auch anderen Vögeln wie dem Schwarzkehlchen Lebensraum bieten. Ein anderer Auenbewohner ist die Nachtigall, die ihren betörenden Gesang gut versteckt im dichten Gebüsch vorträgt, manchmal sogar direkt neben dem Turm.
Hohlwege durchschneiden die Terrassenkante und führen in die Aue. Einige Nebenbäche der Ems bahnen sich ihren Weg zum Fluss. Ihre naturnahen Bachtäler vervollständigen das Bild einer überaus vielfältigen Auenlandschaft.


Reinermanns Steg
„Reinermanns Steg“ heißt die Brücke, die den Radler unweit der Siedlung Sinningen über die Ems führt. Wobei der Ausdruck „Steg“ für das elegant geschwungene Bauwerk nicht ganz passend erscheint. Tatsächlich bezieht der Name sich auf den schlichteren Vorgänger, der hier 1937 erstmals den Brückenschlag vollzog und die bis dahin verkehrende Fähre ersetzte.
Tief blicken lässt die Ems von der Brücke aus nicht. Die Trübung des Wassers ist zu stark. Aufgewirbelte Feststoffe und Plankton verhindern die Sicht auf die Fische, die sich unter der Wasseroberfläche tummeln. Und das sind gar nicht so wenige. Brachsen, Güster, Zander, Flussbarsch, Rotfeder, Schleie, Aal und Hecht kommen mit dem trüben und vergleichsweise sauerstoffarmen Wasser gut klar.
Ganz anders die Bachforelle. Sie braucht klares, kühles und sauerstoffreiche Wasser. Das findet sie in der Ems und anderen größeren Flüssen vor allem im quellnahen Bereich , der deshalb als Forellenregion bezeichnet wird. Die Brachse steht stellvertretend für die Brachsenregion, die den größten Teil des Emslaufes einnimmt und sehr fischreich ist.


Bockholter Fähre
Bis Anfang des 20. Jahrhunderts querten nur wenige Brücken die Ems. Zwischen Greven und Rheine gab es nicht eine – heute sind es immerhin fünf! Kaum vorstellbar, weil die Mitte des 19. Jahrhunderts eröffnete Bahnlinie Münster-Rheine vor allem der Textilindustrie einen großen Aufschwung gebracht hatte und die fehlenden Brücken den Transport der Güter in Ost-West-Richtung erheblich erschwerten. Statt dessen sorgten Fähren dafür, dass Menschen, Tiere und Waren von einem Ufer zum anderen gelangten. Neben kleineren Personenfähren gab es auch solche, die Pferdefuhrwerke aufnehmen konnten.
Die Bockholter Fähre ist das letzte Relikt an der westfälischen Ems aus dieser Zeit. Sie hatte wegen ihrer etwas abseitigen Lage vermutlich nur lokale Bedeutung. Bekannt ist, dass der Besitzer der Hofstelle Bockholt eine Brennerei und auch eine Brauerei betrieb. Ob mit der Fähre auch Hochprozentiges die Emsseiten wechselte, ist aber nicht überliefert. Fest steht nur, dass Heinrich Bockholt 1912 eine Schankerlaubnis bekam unter der Verpflichtung, den öffentlichen Fährbetrieb aufrecht zu erhalten. Das ist bis heute der Fall. Im Sommer heißt es an Wochenenden und Feiertagen: „Fährmann, hol über!“


Emsaue Rheine-Gellendorf
Altwasser, bunte Wiesen, sandige Raine – die Emsaue bei Gellendorf bietet eine große Palette dessen, was eine Flusslandschaft an Lebensräumen aufweist. Wobei der Mensch einen nicht unerheblichen Teil zu der Vielfalt beigetragen hat. Den Wald aus Eichen, Eschen und Erlen, der natürlicherweise in einer Flussaue wächst, hat er früh gerodet, um Heu für das Vieh zu ernten. Ein nicht ganz risikofreies Unterfangen. Immer wieder sorgten Hochwasser zur unpassenden Zeit dafür, dass die Heugarben ein Opfer der Fluten wurden.
Die Begradigung der Ems hat die Bewirtschaftung der Aue erleichtert. Allerdings mit der Folge, dass der Maisanbau an vielen Stellen die traditionelle Grünlandwirtschaft verdrängt hat. In Gellendorf sieht es zum Glück noch anders aus. Das Mosaik aus unterschiedlichen Lebensräumen sorgt für eine große Artenvielfalt. Heidenelke und Sand-Thymian wachsen an mageren Böschungen, Libellen patrouillieren über den Altwassern, und mit gellenden Pfiffen bekundet ein überfliegender Austernfischer lautstark seinen Revieranspruch.


Kloster Bentlage
Das 1437 gegründete Kloster Bentlage gehört zu den am besten erhaltenen Klosteranlagen in Westfalen. Kaum verändert hat sich auch die historische Kulturlandschaft rund um das Kloster, wie ein Vergleich mit historischen Karten zeigt. Die Mönche gestalteten die Landschaft über Jahrhunderte nach ihren Bedürfnissen. Die Wiesen, Wälder, Äcker und Fischteiche rund um das Kloster lieferten alles, was sie zum Leben brauchten. Der Bentlager Busch, einer der ältesten Wälder entlang der Ems, weist noch Spuren der alten Hudewirtschaft auf, bei der die Bauern die Schweine zur Eichel- und Bucheckernmast in den Wald trieben.
Die Wiesen sind heute größtenteils drainiert. Während der Mahd finden sich oft Weißstörche aus dem benachbarten Naturzoo Rheine ein, um sich die aufgescheuchten Mäusen und Frösche einzuverleiben.
Das Kloster selbst ist heute ein Zentrum für zeitgenössische Kunst. Unweit des Klosters ist die Saline Gottesgabe eine weitere kulturhistorische Besonderheit am Ende des westfälischen Teils des EmsRadweges. An den beiden Gradierwerken wachsen Pflanzen, die sonst in den Salzwiesen entlang der Küste zu Hause sind.